
Aktualisiert: 25.11.2025
Vitamin D: Fragen & Antworten
Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und ist vor allem für seine Funktionen beim Knochenstoffwechsel bekannt. Auch für das Immunsystem spielt es eine wichtige Rolle.
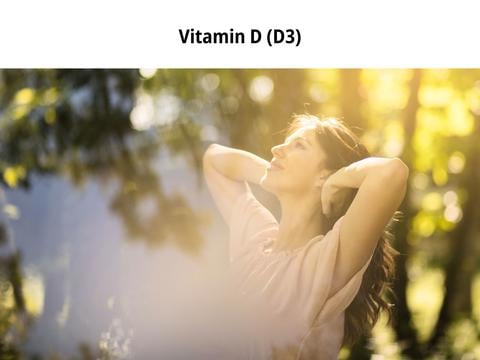
Vitamin D ist wie das Vitamin A ein fettlösliches Vitamin. Wobei der Begriff Vitamin nur bedingt korrekt ist, denn genau genommen handelt es sich bei Vitamin D um die Vorstufe eines Hormons. Vitamine sind nämlich dadurch gekennzeichnet, dass sie der Körper normalerweise selbst nicht produzieren kann und somit über die Nahrung zuführen muss.
Was ist mit Vitamin D gemeint?
Grundsätzlich wird unter dem Sammelbegriff Vitamin D eine Gruppe von Vitaminen verstanden, von denen insbesondere Ergocalciferol (Vitamin D2) und Cholecalciferol (Vitamin D3) relevant sind. Vitamin D wird als einziges Vitamin von unserem Körper aus der Sonnenstrahlung selbst produziert. Diese körpereigene Bildung durch UV-B-Strahlung macht bis zu 90 Prozent aus. Lebensmittel tragen lediglich rund 10 Prozent zu unserer Versorgung mit Vitamin D bei. Das Vitamin D unterstützt die Aufnahme von Calcium und Phosphat aus dem Darm und fördert den entsprechenden Einbau in unsere Knochen. Die wichtigste Aufgabe ist demnach die Funktion beim Knochenstoffwechsel.
Was ist Vitamin D?
Vitamin D hat einen ganz besonderen Stellenwert im Hinblick auf essenzielle Vitamine. Denn der menschliche Körper ist in der Lage, das Vitamin aus bestimmten Vorstufen im Organismus selbst zu bilden. Dafür brauchen wir das Sonnenlicht. Genau genommen ist es die UV-B-Strahlung, die über die Haut den Organismus zur Bildung des Vitamins anregt.
Was ist Vitamin D3?
Im Zusammenhang mit Vitamin D liest man häufig von Vitamin D3. Dabei handelt es sich um die im Körper wirksame Form der fettlöslichen Verbindungen, die unter dem Sammelbegriff Vitamin D zusammengefasst werden. Dieser bekannteste Vertreter der Gruppe ist zumeist gemeint, wenn von Vitamin D die Rede ist. In der Fachsprache wird Vitamin D3 auch als Colecalciferol oder Cholecalciferol bezeichnet. Leber und Nieren wandeln Vitamin D3 in ein aktives Hormon namens Calcitriol um. Es kann außerdem in Calcifediol und damit in eine Speicherform überführt werden.
Wie wurde Vitamin D entdeckt? Geschichte von Vitamin D
Die Entdeckung von Vitamin D hängt mit der Suche nach einem Heilmittel gegen Rachitis – einer Knochenkrankheit bei Kindern und Jugendlichen – zusammen. 1919 fand man heraus, dass künstliches UV-Licht Rachitis heilen kann – später wurde klar, dass auch natürliches Sonnenlicht dazu in der Lage ist. Gleichzeitig zeigte ein britischer Forscher, dass mit bestimmten Lebensmitteln wie Lebertran Rachitis ebenso behandelt werden konnte. Zunächst dachte man, Vitamin A sei dafür verantwortlich, doch selbst oxidierter Lebertran (also jener ohne wirksames Vitamin A) war gegen Rachitis wirksam. So erkannte man, dass wohl ein anderes Vitamin zuständig sein musste – und nannte es als viertes der gefundenen Vitamine nach A, B und C schließlich Vitamin D.
Welche Aufgaben hat Vitamin D?
Vitamin D beeinflusst die Muskelkraft und ist an verschiedenen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Die bekannteste Aufgabe von Vitamin D ist seine Funktion in der Verstoffwechselung von Calcium und Phosphat. Es unterstützt bei der Aufnahme beider Stoffe aus dem Darm und hilft dabei, sie in die Knochen einzubauen. Das Vitamin D ist damit für die Knochenmineralisierung unerlässlich. Untersuchungen belegen, dass Menschen mit einer guten Versorgung mit Vitamin D im Alter ein geringeres Risiko für Kraftverlust, Knochenbrüche und Einbußen von Mobilität aufweisen.
Wir brauchen Vitamin D allerdings nicht nur für stabile Knochen, sondern es ist auch an anderen wichtigen Funktionen des Körpers beteiligt. Dazu gehören:
-
Reibungsloses Funktionieren verschiedener Zellen in den Muskeln, der Bauchspeicheldrüse oder im Gehirn
-
Optimaler Blutdruck, gute Herzmuskel-Leistung und Gefäßgesundheit
-
Schutz unserer Nervenzellen
-
Gesunde Schwangerschaft
-
Stärkung des Immunsystems
Vitamin D und das Immunsystem
In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer klarer, dass Vitamin D auch für unser Immunsystem von zentraler Bedeutung ist. Vor allem bei der unspezifischen Immunabwehr spielt es eine große Rolle. So finden sich Vitamin-D-Rezeptoren auf allen Leukozyten. Es beeinflusst allerdings auch die spezifische Immunantwort. Entsprechende Untersuchungen belegen also, dass Vitamin D sich auf wesentlich mehr Funktionen als nur den Bewegungsapparat auswirkt und eine immunmodulierende Wirkung aufweist. Ein geschwächtes Immunsystem kann durch Vitamin D gestärkt werden. Das legt nahe, dass eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung nicht nur bei Säuglingen und älteren Menschen von entsprechender Wichtigkeit ist. Die aktuellen Forschungsergebnisse legen nahe, dass Vitamin D sich auf den Verlauf von Infektionen bzw. das Risiko, daran zu erkranken, auswirkt.
Worin ist Vitamin D enthalten?
Im Unterschied zur körpereigenen Vitamin D-Bildung hat die Zufuhr des Vitamins über die Ernährung eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Es ist in Nahrungsmitteln auch nur in begrenzten Mengen vorhanden. Fehlt die körpereinige Bildung von Vitamin D, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die Zufuhr von täglich 20 Mikrogramm (µg) Vitamin D. Es ist beispielsweise in folgenden Lebensmitteln in relevanten Mengen enthalten:
-
100 Gramm Hering – bis zu 25 µg
-
100 Gramm Lachs – 16 µg
-
100 Gramm Eigelb – 5,6 µg
-
100 Gramm Makrele – 4 µg
-
100 Gramm Champignons – 1,9 µg
-
100 Gramm Rinderleber – 1,7 µg
-
100 Gramm Butter – 1,20 µg
Wie wird Vitamin D gebildet und wieviel brauchen wir?
Vitamin D wird von unserem Körper durch die UV-B-Strahlung des Sonnenlichts selbst gebildet. Dabei wird Vitamin D3 in das Hormon Calcitriol umgewandelt. Sieht man sich diesen Vorgang genauer an, stellt man fest, dass durch die Sonnenstrahlung zunächst im Körper Provitamin D produziert wird. In der Haut wird dieser Stoff schließlich in ein fettlösliches Vitamin umgewandelt. Man nennt es Cholecalciferol. Nun kommt es zu einem weiteren Umbau in der Leber, wodurch daraus Calcidiol entsteht. Dabei handelt es sich um eine noch inaktive From von Vitamin D3. Dieser Calcidiol-Gehalt ist vor allem bei der Bestimmung des Vitamin D-Spiegels wesentlich. Damit sich ausreichend Vitamin D bilden kann, muss man sich dem Sonnenlicht aussetzen. Empfehlenswert ist es daher, sich täglich zwischen fünf und 25 Minuten in die Sonne zu begeben, ohne dabei Gesicht, Hände und größere Bereiche an Armen oder Beinen zu bedecken. Wie viel Vitamin D in der Haut dabei gebildet wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Dazu gehören:
-
Hauttyp
-
Dauer des Aufenthalts im Freien
-
Kleidung
-
Jahreszeit
-
Tageszeit
-
Wetter
-
Breitengrad
-
Sonnenschutzmittel
In den Sommermonaten ist es in unseren Breiten möglich, die empfohlene Blutserumkonzentration von 50 Nanomol pro Liter (nmol/l) Vitamin D zu erreichen. Allerdings ist die körpereigene Bildung von den oben genannten sowie weiteren individuellen Faktoren abhängig, wodurch der Beitrag zur Vitamin D-Versorgung stark schwanken kann. Der Körper ist in der Lage, Vitamin D im Fettgewebe sowie in den Muskel zu speichern. Dieser körpereigene Speicher ist relativ groß. Das ist wichtig, damit der Organismus auch im Winter mit Vitamin D versorgt ist. Denn zwischen Oktober und März reicht die Sonnenstrahlung alleine bei uns nicht aus, um ausreichend Vitamin D zu bilden.
Wie viel Sonne brauchen wir für Vitamin D?
Wie viel Sonne wir für die Bildung von ausbrechend Vitamin D benötigen, hängt unter anderem von der Jahreszeit, der Witterung und dem individuellen Hauttyp ab.
Menschen mit einem hellen Hauttyp, also heller bis sehr heller Haut, hellen roten oder blonden Haaren sowie blauen oder grünen Augen sollten sich von März bis Mai rund 10 bis 20 Minuten, von Juni bis August 5 bis 10 Minuten und von September bis Oktober 10 bis 20 Minuten dem Sonnenlicht für eine ausreichende körpereigene Vitamin D Bildung aussetzen. Bei dunkleren Hauttypen – also mittlere Hautfarbe bei dunklen Haaren und brauen Augen – gilt die Empfehlung, im Frühling 15 bis 25 Minuten, im Sommer 10 bis 15 Minuten und im Herbst 15 bis 25 Minuten Sonnenlicht pro Tag. Am Vormittag sowie am Nachmittag ab 15 Uhr kann die Zeit in der Sonne verdoppelt werden.
Wie viel Vitamin D brauchen wir?
Um im Sommer ausreichend Vitamin D zu bilden, sollten wir täglich zwischen März und Oktober mehrere Minuten Sonnenlicht tanken und dabei darauf achten, dass z. B. Unterarme und Beine sowie unser Gesicht nicht bedeckt sind. Im Winter sorgt der körpereigene Speicher dafür, dass wir auch in der dunklen Jahreszeit ausreichend mit Vitamin D versorgt sind, bevor sich die geleerten Speicher im Frühling wieder auffüllen können.
Um herauszufinden, wie hoch der Vitamin D-Spiegel eines Menschen ist, wird der Gehalt an Calcidiol – einer Zwischenstufe von Vitamin D3 – im Blut gemessen. Im Optimalfall liegt dieser Wert zwischen 40 und 90 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml). Genauer aufgeschlüsselt bedeutet das:
-
Kritischer Vitamin D-Spiegel: unter 20 ng/ml
-
Niedriger Vitamin D-Spiegel: bis 20 ng/ml
-
Ausreichender Vitamin D-Spiegel: bis 30 ng/ml
-
Guter Vitamin D-Spiegel: bis 40 ng/ml
-
Optimaler Vitamin D-Spiegel: bis 60 ng/ml
-
Hoher Vitamin D-Spiegel: bis 90 ng/ml
Die Zufuhr von Vitamin D über die Ernährung spielt im Gegensatz zur Bildung aus Sonnenlicht eine untergeordnete Rolle. Bei einer fehlenden körpereigenen Bildung liegt der Referenzwert für Vitamin D laut Schätzungen bei etwa 20 Mikrogramm täglich.
Was passiert bei Vitamin-D-Mangel?
Ein Vitamin D-Mangel kann verschiedene Folgen haben. Dazu gehören die folgenden Symptome:
-
Störung des Knochenstoffwechsels
-
Erweichte Knochen (Osteomalazie)
-
Osteoporose (bei älteren Personen)
-
Verringerte Muskelkraft
-
Infektanfälligkeit
-
Haarausfall
-
Rachitis: weiche und verformte Knochen (bei einem Mangel im Säuglings- oder Kindesalter)
Was essen bei Vitamin-D-Mangel?
Die passende Ernährung spielt bei einem Vitamin D-Mangel eine weniger bedeutende Rolle als bei anderen Vitaminen. Der Großteil des Vitamin D wird nämlich im Normalfall vom Körper selbst mithilfe der Sonneneinstrahlung produziert. Wer auch auf eine optimale Zufuhr von Vitamin D durch die Ernährung setzen möchte, sieht sich mit einer relativ geringen Menge an entsprechenden Lebensmitteln konfrontiert, die in relevantem Maße Vitamin D enthalten. Dazu gehört for allem fetter Fisch, wie Hering oder Lachs. Vitamin D haltige Lebensmittel sind zumeist tierischen Ursprungs. In manchen Speisepilzen finden sich allerdings auch nennenswerte Mengen an Vitamin D. Da wir mit einer durchschnittlichen Ernährung in unseren Breiten relativ wenig Vitamin D zuführen, gilt die Empfehlung, in der wärmeren Jahreszeit ausreichend oft nach draußen zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Haut genügend Sonnenstrahlung bekommt.
Wann sind Vitamin-D-Präparate empfohlen?
Vor allem in den Wintermonaten, wenn die UV-B-Strahlung in unseren Breiten gering ist, ergibt sich in bestimmten Fällen die Empfehlung einer optimierten Vitamin D-Versorgung. Um die unspezifische Immunabwehr zu optimieren und Infekten vorzubeugen, kann es daher ratsam sein, Vitamin D zuzuführen. Insbesondere dann, wenn die Versorgung gezielt verbessert werden soll. Das kann bei Menschen mit erhöhtem Risiko für einen Vitamin D-Mangel der Fall sein.
Zu den Risikogruppen gehören:
-
Säuglinge und Kinder im ersten Lebensjahr
-
Menschen, die sich nicht oder nur wenig draußen aufhalten können
-
Personen, die sich z. B. aus religiösen Gründen nur mit bedecktem Körper im Freien aufhalten
-
Menschen mit dunkler Hautfarbe (je höher der Gehalt an Melanin, desto weniger Vitamin D kann gebildet werden)
-
Senior:innen
Ältere Menschen zählen nicht nur zur Risikogruppe für einen Vitamin D-Mangel, weil sie sich aufgrund von eingeschränkter Mobilität, chronischen Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit durchschnittlich weniger im Freien aufhalten. Im Alter nimmt außerdem die Fähigkeit des Körpers, Vitamin D selbst zu bilden, generell ab. Sie kann im Vergleich zu jungen Menschen sogar auf die Hälfte oder noch weniger reduziert sein.
Die Dosis von Vitamin D wird auf entsprechenden Präparaten häufig mit dem Kürzel I.E. angegeben. Es steht für „Internationale Einheiten“. Wie viele Einheiten ein Mensch braucht, hängt von seinem aktuellen Vitamin D-Spiegel sowie von individuellen Faktoren wie dem Körpergewicht ab.
Vitamin D3 und Vitamin K2 in Kombination
Bei der Supplementierung von Vitamin D3 ist häufig von der Kombination mit Vitamin K2 zu lesen. Vitamin K kann mit Obst und Gemüse aufgenommen werden (Vitamin K1) oder über fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut (Vitamin K2). Menachinon – wie Vitamin K2 auch genannt wird – kann überdies von bestimmten Darmbakterien gebildet werden. Vitamin K2 trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei und aktiviert Proteine, die der Körper benötigt, um sich Vitamin D3 zunutze zu machen. Anders ausgedrückt: Vitamin K2 unterstützt die positiven Auswirkungen von Vitamin D3. Eine offizielle Empfehlung, Vitamin D mit Vitamin K zu kombinieren, gibt es allerdings nicht. Wesentlich ist für die normale Funktion des Organismus, dass er mit beiden Vitaminen ausreichend versorgt ist. Während man den Bedarf an Vitamin K über eine ausgewogene Ernährung mit der Nahrungsaufnahme decken kann, ist die ausreichende Versorgung mit Vitamin D über Lebensmittel alleine nicht möglich.
Vitamin D bei Kindern
Gerade Babys und Kinder benötigen Vitamin D, um gesunde Knochen zu bilden und für ihr Wachstum. Um etwa Rachitis vorzubeugen, geht man von einem täglichen Bedarf von 10 Mikrogramm Vitamin D aus. Doch in Muttermilch ist zu wenig Vitamin D enthalten und Babys sind noch nicht in der Lage, das wichtige Vitamin selbst in ausreichender Menge zu produzieren. Zumal die empfindliche Haut von Babys bei Sonneneinstrahlung ausreichenden Sonnenschutz benötigt, der die Bildung von Vitamin D wiederum reduziert. Es wird daher empfohlen, Babys zusätzlich Vitamin D in Form von Tropfen oder Tabletten zuzuführen.
Zu viel Vitamin D?
Lebensmittel grundsätzlich mit Vitamin D anzureichern, ist aktuell nicht empfohlen. Die Bildung von Vitamin D über die Haut durch die Sonnenstrahlen sollte im Vordergrund stehen. Ärzt:innen empfehlen dann kein Vitamin D, wenn es ohne Bedarfscheck langfristig hochdosiert eingenommen wird. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass täglich 4.000 I.E. Vitamin D über einen längeren Zeitraum bei älteren Frauen mit einer stärkeren Verringerung der Knochendichte sowie bei Menschen mit Herzkrankheiten mit einer Verschlechterung der Herzfunktion einhergehen könnten. Unüblich hohen Dose könnten sogar zu einer sogenannten „Vitamin-D-Vergiftung“ führen.
Was passiert bei zu viel Vitamin D?
Eine Überdosierung mit Vitamin D ist weder durch zu viel Sonne noch durch eine übliche Ernährung zu erreichen. Es ist allerdings möglich, bei deutlich überhöhter Zufuhr von Vitamin D über entsprechende Präparate eine Vitamin-D-Intoxikation herbeizuführen.
Diese zeigt sich in:
-
Erhöhten Calciumwerten im Blut
-
Muskelschwäche
-
Herzrhythmusstörungen
-
Gewichtsverlust
-
Nierensteinen
-
Nierenverkalkung
-
Reduzierter Nierenfunktion
Um eine langfristige Überdosis von Vitamin D zu verhindern, sollten entsprechende Präparate bestimmungsgemäß eingenommen und nicht selbstständig hochdosiert werden.
Zusammenfassung: Vitamin D
Hier haben wir die wichtigsten Infos zu Vitamin D in einer Tabelle zusammengefasst:
|
Was ist Vitamin D? |
Fettlösliches Vitamin, das der Körper durch Sonnenlicht selbst bilden kann |
|
Vitamin D3 (Cholecalciferol) |
Wirksame Form von Vitamin D, wird im Körper in aktives Hormon (Calcitriol) umgewandelt. |
|
Entdeckung |
1919 als Mittel gegen Rachitis entdeckt – Sonnenlicht und Lebertran zeigten Wirkung |
|
Funktion im Körper |
Wichtig für Knochen, Muskeln, Immunsystem, Nerven, Blutdruck und Schwangerschaft |
|
Immunsystem |
Unterstützt unspezifische und spezifische Immunabwehr, wirkt immunmodulierend |
|
Quellen in Lebensmitteln |
Besonders in Hering, Lachs, Eigelb, Makrele, Pilzen und Leber enthalten |
|
Körpereigene Bildung |
UVB-Strahlen regen Haut zur Vitamin-D-Produktion an; Speichermöglichkeit im Fettgewebe |
|
Sonne & Hauttyp |
Dauer der Sonnenbestrahlung hängt von Hauttyp, Jahreszeit und Kleidung ab |
|
Tagesbedarf |
Bei fehlender Sonnenbildung ca. 20 µg täglich nötig; optimaler Blutwert: 40–60 ng/ml |
|
Mangel-Symptome |
Knochenprobleme, Muskelschwäche, Infekte, Haarausfall, Rachitis bei Kindern |
|
Ernährung bei Mangel |
Fetter Fisch, Pilze und ggf. Nahrungsergänzung empfohlen – Sonne bleibt Hauptquelle |
|
Wann Präparate sinnvoll sind |
Winter, wenig Sonnenkontakt, dunkle Haut, ältere Menschen, Babys (prophylaktisch) |
|
Kinder & Babys |
Brauchen Vitamin-D-Zufuhr, da Muttermilch zu wenig enthält und Sonne vermieden wird |
|
Warum keine generelle Empfehlung? |
Gefahr bei langfristiger Hochdosierung (z. B. Knochendichte-Verlust, Herzprobleme) |
|
Überdosierung (Intoxikation) |
Nur durch hochdosierte Präparate möglich – Symptome: Übelkeit, Nierenprobleme, Calciumüberschuss |

pegaso® Junior
Nahrungsergänzungsmittel mit Milchsäurebakterien und Kamille, kombiniert mit Vitamin A. Zusätzlich trägt das Vitamin D3 zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei Kindern bei.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.
Orale Suspension: 10 ml
Autoren: Redaktionsteam Schwabe Austria
Disclaimer: Die Informationen auf dieser Website sind keinesfalls ein Ersatz für den persönlichen Besuch bei Arzt, Apotheker oder anderen medizinischen Fachpersonen. Die Gesundheitsartikel sind als Impulse zu verstehen, mit dem Ziel, sich näher mit Themen der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen und entsprechende Unterstützung zu suchen.
Quellen:
A. Zittermann, S. Pilz, W. März, Vitamin D und Infektanfälligkeit, https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0035-1552694.pdf
V. Schmiedel, Wie wir das Immunsystem gezielt stärken können, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8423507/
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Vitamin D, https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/vitamine-mineralstoffe/fettloesliche-vitamine/vitamin-d.html
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Vitamin D, https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/faq/vitamin-d/
Apothekerkammer Salzburg, Ich check’s jetzt – Mein Vitamin D-Wert, https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Bundeslaender/Salzburg/VIT-D-Broschuere_web.pdf
Robert Koch-Institut, Antworten des Robert Koch-Instituts auf häufig gestellte Fragen zu Vitamin D, https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html
Internisten im Netz, Vorsicht vor hochdosiertem Vitamin D, https://www.internisten-im-netz.de/aktuelle-meldungen/aktuell/vorsicht-vor-hochdosiertem-vitamin-d.html
DocCheck Flexicon, Vitamin-D-Mangel, https://flexikon.doccheck.com/de/Vitamin-D-Mangel
Gesundheitsinformation.de, Warum wird empfohlen, Babys Vitamin D zu geben?, https://www.gesundheitsinformation.de/warum-wird-empfohlen-babys-vitamin-d-zu-geben.html
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Vitamin K, https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/vitamine-mineralstoffe/fettloesliche-vitamine/vitamin-k.html
Beratungsleitfaden Kombination von Vitamin D3 und Vitamin K2, DeutschesApothekenPortal, https://www.deutschesapothekenportal.de/beratung/beratungsleitfaeden/kombination-von-vitamin-d3-und-vitamin-k2/
Kombination Vitamin D und Vitamin K2, Verbraucherzentrale, https://www.verbraucherzentrale.de/faq/lebensmittel/kombination-vitamin-d-und-vitamin-k2-39144